Lock-In-Thermografie
Präzise Fehlstellenanalyse bis unter die Oberfläche
Mit Lock-in-Thermografie werden Bauteile mit periodisch moduliertem Wärmeeintrag angeregt und mit einer Infrarotkamera aufgenommen. Aus der gemessenen Bildsequenz entstehen Phasen- und Amplitudenbilder, die Delaminationen, Lufteinschlüsse, Klebefehler oder Materialdicken-Schwankungen zuverlässig sichtbar machen. Berührungslos, zerstörungsfrei, inline-fähig.
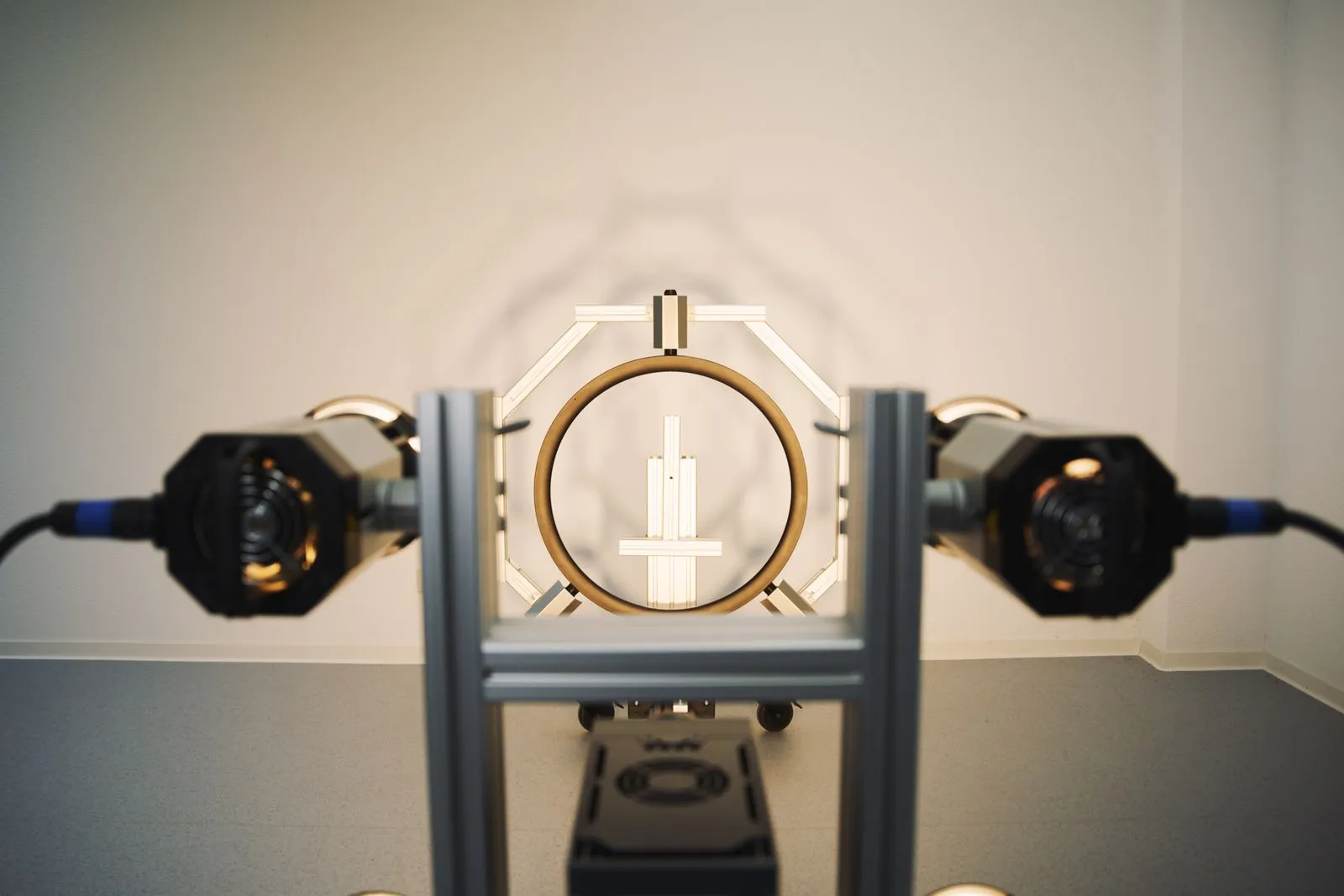
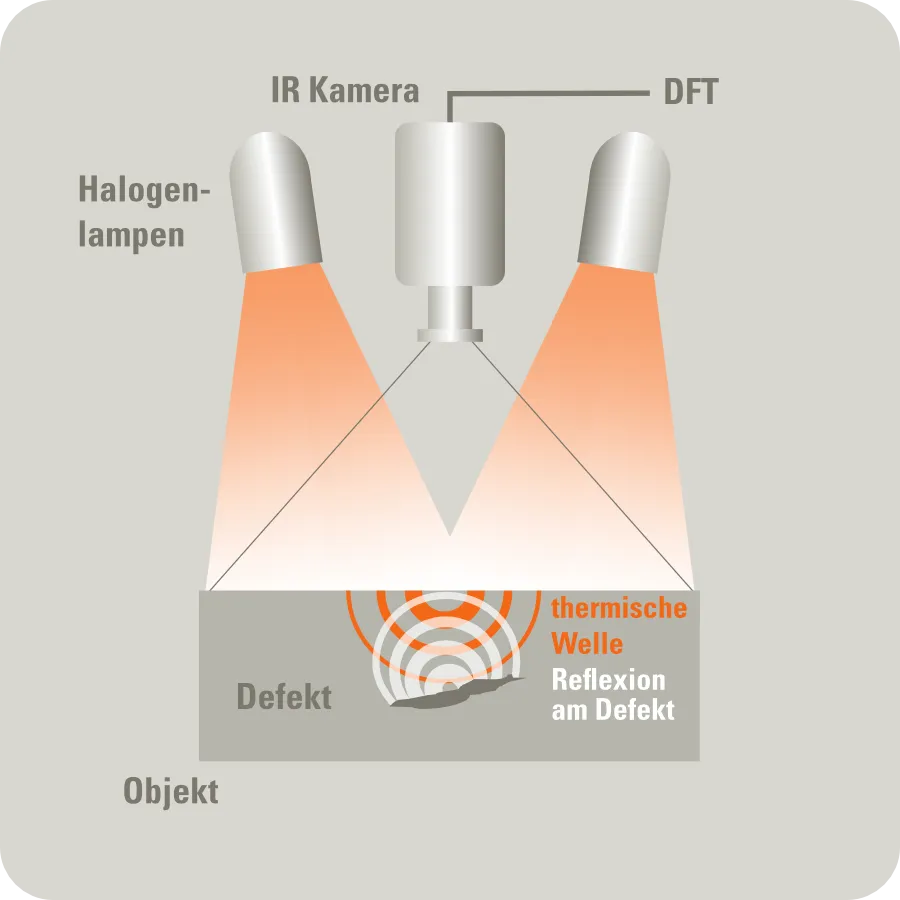
Was ist Lock-In-Thermografie? - Kurz erklärt
Vorteile
Tiefenaufgelöste Fehlererkennung bei typischen Verbund-/Schichtaufgaben
Großflächige Prüfungen in einem Durchgang (statische Setups)
Phasenanalyse reduziert Störeinflüsse (Emissionsgrad/Beleuchtung)
Berührungslos, zerstörungsfrei, inline-fähig & automatisierbar
Anwendungen
Faserverbund & Leichtbau (CFK/GFK)
Klebetechnik & Kunststoffschweißen
Metalle & Hybride wie Karrosionsunterwanderungen, Wanddickenänderungen, Verbünde & beschichtete Bleche
Großstrukturen wie Rotorblätter, Karosserieaußenhäute, Paneele
Aufbau der Prüfung – Bewegung
Hinweis: Lock-in ist die Anregungsart dieser Seite. Puls (PTvis) und Step (IR-Radiator) gehören ebenfalls zur optischen Familie, werden aber hier nicht näher beschrieben.
Bewegung wählen
Typische Anwendungen
- CFK-Bauteile (Delamination, Impact, Porosität, Insert-Anbindung),
- strukturelle Klebeverbindungen (Luftfahrt, Automotive),
- Schicht-/Wanddickenmessung an beschichteten Metallen,
- Korrosion unter Lack, Kunststoff-Schweißverbindungen, Rotorblätter.
Vorteile
Ein sehr hoher Signal-Rausch-Abstand, präzise Tiefenauflösung durch lange Integrationszeit bzw. Frequenz-Sweep sowie reproduzierbare Ergebnisse machen das System ideal für Laborserien und Vorstufen zur Inline-Prüfung.
Typische Anwendungen
- Lange Klebenähte bei Förderbandgeschwindigkeit
- Großflächen-Kontrolle (Rotorblätter, Paneele)
- dynamische Stichproben an Großstrukturen
Vorteile
Deutliche Zeitersparnis bei großen Prüfflächen; einfache Integration in Robotik-, Portal- oder Achssysteme.
Berechnung: Thermische Eindringtiefe
Die Lock-in-Frequenz bestimmt, wie tief die thermische Welle ins Material eindringt. Die maßgebliche Größe dafür ist die thermische Eindringtiefe μ, die wiederum von der Temperaturleitfähigkeit α und der Anregungsfrequenz f abhängt.
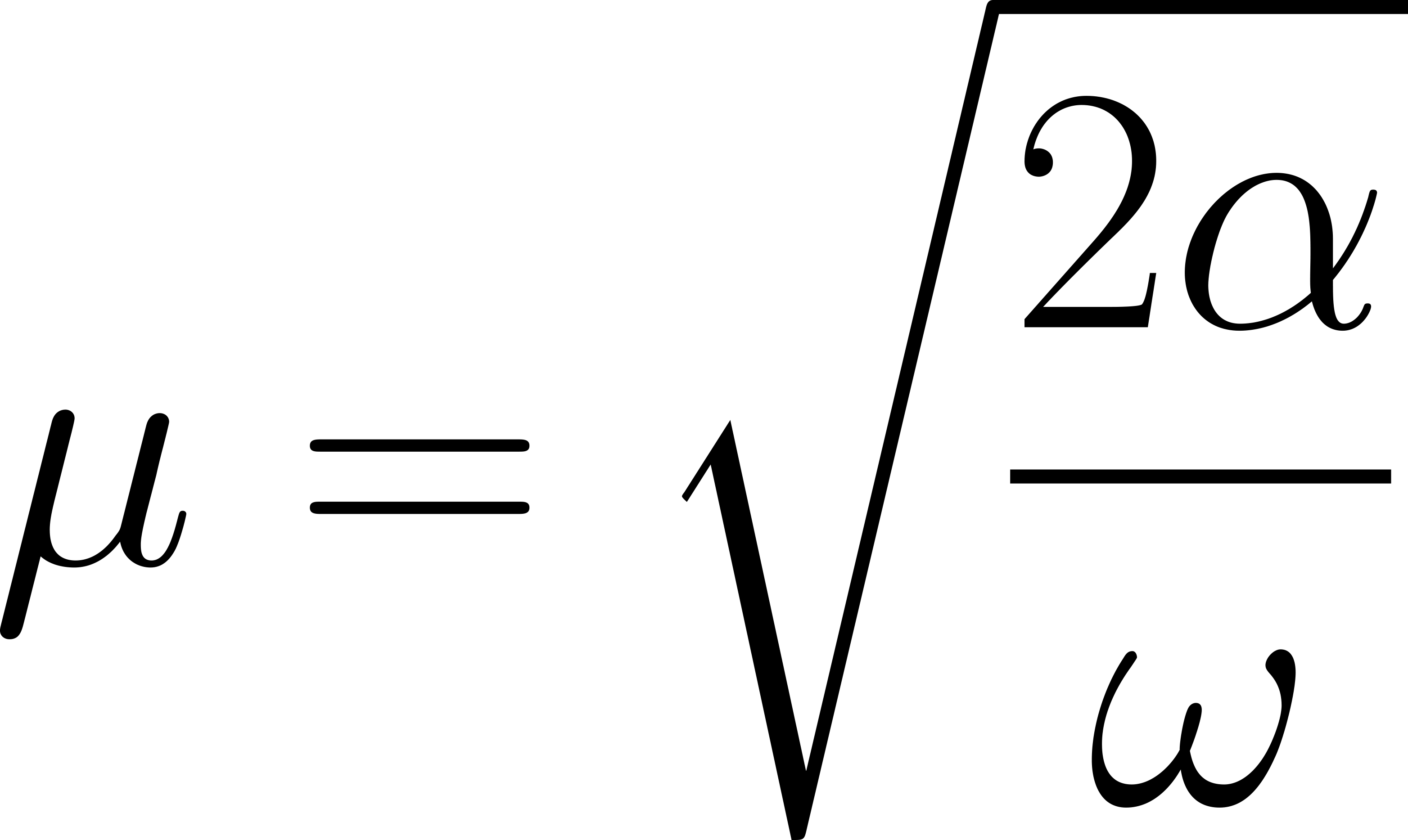
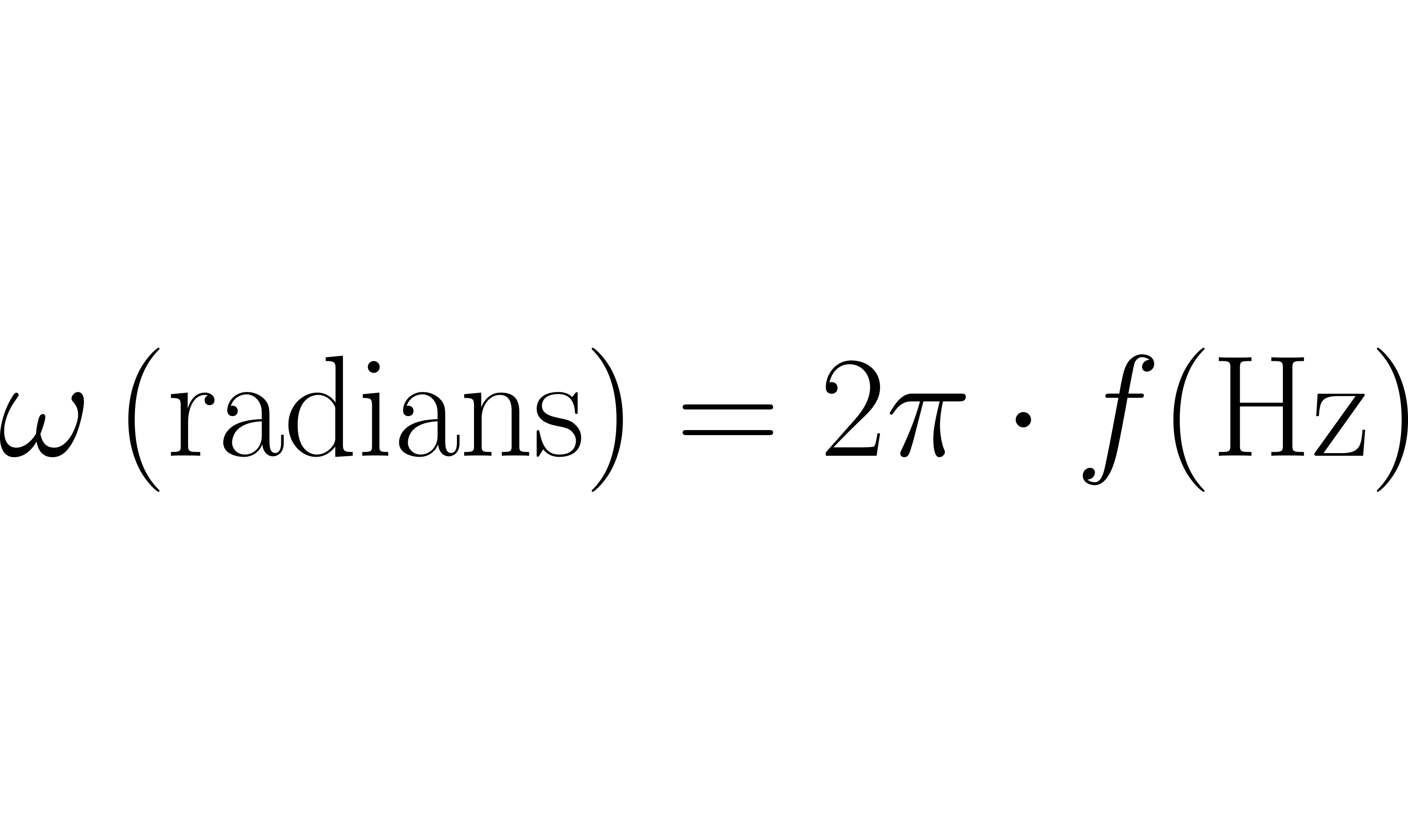
Fragen zu Lock-In-Thermografie?
In einem kurzen Erstgespräch klären wir, wie wir Sie sinnvoll unterstützen können – klar, transparent und unverbindlich.
FAQ
Unsere häufig gestellten Fragen – einfach und schnell beantwortet.




